
Ihre Mission: patriarchale Strukturen im Gründungsökosystem sichtbar machen und Alternativen schaffen, die Care, Verantwortung und Machtumverteilung ernst nehmen. „Found(h)er: Warum Gründung nicht männlich sein muss““ ist ihre Kolumnenreihe über Mythen, Macht und Möglichkeiten in der Startup-Welt. Sie dekonstruiert das Bild des genialen Einzelkämpfers, analysiert Bro Culture und erzählt, wie echte Innovation entsteht, wenn Care und Kapital nicht länger Gegensätze sind.
Episode
34
▪
Found(h)er: Warum Gründung nicht männlich sein muss
Der Gründer-Mythos & männliche Narrative
Der Mythos vom einsamen, brillanten Gründer & und warum er nicht stimmt
Er war allein in seiner Garage. Nur ein Laptop, ein Traum und der Glaube, dass er die Welt verändern kann.
So erzählen wir sie, die Gründungsgeschichten der Moderne.
Steve in Cupertino. Jeff in Seattle und Elon…wo war Elon eigentlich? Wahrscheinlich in Space…naja.
Das Drehbuch ist aber auf jeden Fall immer dasselbe: Ein Mann, eine Idee, ein Kult drumherum.
Doch die Wahrheit ist: Diese Geschichte ist nicht nur unvollständig, sondern auch strukturell fragwürdig.
Der „Garagenmythos“ ist das Märchen unserer Zeit.
Er erzählt vom Genie, das gegen alle Widerstände siegt. Vom Selfmade-Man, der nur sich selbst vertraut.
Aber er verschleiert sehr gut, was wirklich hinter Erfolg steckt: Netzwerke, Geld, Klassenprivilegien und eine ganze Menge unsichtbarer Arbeit, die andere für ihn leisten.
Weniger als ein Drittel aller Unternehmen startet tatsächlich in Garagen oder Kellern¹. Die „Garage“ ist kein Arbeitsplatz, sondern eine Bühne. Ein Symbol für das meritokratische Versprechen “Wer nur hart genug arbeitet, schafft es”. Es ist der Traum vom Aufstieg, der vollkommen entkoppelt von Herkunft, Ressourcen oder Absicherung daherkommt. Ein Traum, der sich in einer Gesellschaft, die strukturelle Ungleichheit liebt, besonders gut vermarktet.
Gründen ist kein Soloprojekt
Forschungen zeigen schon längst, Entrepreneurship ist kein Akt des einzelnen Genies, sondern ein sozialer Prozess². Die erfolgreichsten Gründer*innen bringen nicht nur Ideen mit, sondern vor allem Zugang zu Kapital, Mentoring und Netzwerken.
Das klingt nach „Chancen durch Gemeinschaft“, ist aber in Wahrheit oft ein anderes Wort für strukturelle Exklusivität. Denn wer diese Zugänge hat, ist selten zufällig vernetzt. Immer häufiger werden Gründer*innen heute sogar gezielt von Investor*innen in bestehende Unternehmen eingesetzt. Nicht, weil sie eine Idee haben, sondern weil sie in ein System passen.
Empirie und Realität stehen sich hier oft gegenüber: Während das Gründungsökosystem Exklusivität produziert, zeigt Forschung wie die Panel Study of Entrepreneurial Dynamics³, dass echte Innovation selten linear oder individuell verläuft, sondern in sozialen Prozessen entsteht. So mit Feedback, Scheitern, Korrektur usw. - ihr wisst - aber vor allem mit TEAMARBEIT.
Und doch hält sich das Bild vom „Einzelkämpfer“.
Warum?
Weil es einfacher ist, Helden zu feiern als Systeme zu analysieren.
Die männliche Codierung von Genialität
Der einsame Gründer ist nicht nur ein wirtschaftliches, sondern vor allem auch ein kulturelles Produkt.
Unsere Gesellschaft assoziiert „Genie“ mit Männlichkeit. Studien zeigen, dass in Fächern, in denen Erfolg als Ergebnis angeborener Brillanz gilt, der Frauenanteil besonders niedrig ist⁵. Der „brillante Kopf“ ist also nicht neutral, er ist männlich kodiert.
Und diese Kodierung zieht sich durch die Startup-Welt. Männer gelten als „Visionäre“. Frauen als „Teamplayerinnen“. Ironischerweise beschreibt Letzteres die Realität erfolgreicher Gründung viel besser, aber dafür gibt’s eben nunmal selten Funding.
2024 flossen weltweit nur 2,3 % des globalen Venture Capitals an rein weiblich geführte Teams⁴.
Das sind 6,7 Milliarden von 289 Milliarden US-Dollar. 83,6 % gingen an Männer. Die restlichen 14 % an Mixed-Gender-Teams.
Diese Zahlen sind für mich keine Statistik, sondern eher eine Art Diagnose.
Denn wenn Kapital Macht bedeutet, dann zeigt sich hier, wer die Erzählung vom Genie kontrolliert. (In dem Fall kontrolliert, wer finanziert wird - logisch, oder?)

Wir suchen zukünftige Gründer:innen & Selbstständige, die ihren Bildungsgutschein einlösen wollen, um in 4 Monaten alles über die Gründung lernen in direkter Zusammenarbeit mit erfahrenen Gründer:innen. Hier mehr erfahren
Der unsichtbare Unterbau des Erfolgs
Der Garage-Mythos hat einen blinden Fleck: Care-Arbeit. Die Arbeit, die unsichtbar bleibt, weil sie nicht auf Investor*innen- und Pitch-Decks steht.
Während der Gründer „rund um die Uhr“ arbeitet, hält irgendjemand seinen Alltag am Laufen. Der*die Partner*in, die den Haushalt schmeißt, damit er pitchen kann. Die Mutter, die Kinderbetreuung übernimmt. Der*die Freund*in, die emotionalen Support leistet, wenn’s gerade mal nicht so läuft. Diese Care-Arbeit (emotional, physisch, sozial) ist der missachtete Motor des Kapitalismus. Ohne sie gäbe es keinen „self-made man“.
Feministische Ökonom*innen wie Nancy Fraser nennen das den „versteckten Unterbau der Akkumulation“⁶: Jede ökonomische Leistung basiert auf unbezahlter (oder unterbewerteter) Fürsorgearbeit. Und diese Arbeit leisten überwiegend Frauen.
Der Garagenheld ist also nicht allein. Er steht auf einem Fundament aus unsichtbarer Unterstützung. Nur spricht einfach nie jemand darüber (abgesehen von mir jetzt, klar).
Klassenfragen, die keiner stellt
Auch soziale Herkunft entscheidet, wer gründen kann. Laut einer Studie der London School of Economics (2024) stammen 78 % aller Tech-Gründer*innen in Europa aus der oberen Mittelschicht oder wohlhabenden Haushalten⁷. Wer kein Sicherheitsnetz hat, kann sich kein Scheitern leisten und damit auch kein „unternehmerisches Risiko“.
Der Mythos vom „self-made Entrepreneur“ funktioniert also nur, wenn man ausblendet, wie teuer Unabhängigkeit eigentlich ist.
Warum wir andere Gründungsgeschichten brauchen
Das Problem mit Mythen ist nicht, dass sie falsch sind. Sondern dass sie so schön klingen, dass man sie nicht mehr hinterfragt.
Der Garage-Mythos erzählt uns, dass Erfolg eine Frage von Talent ist. Das stimmt aber nicht. Erfolg ist eine Frage von Strukturen, von Zugang, von Sicherheit und von Care.
Wenn wir wirklich über Innovation und geile Founders sprechen wollen, dann müssen wir auch über all die Menschen sprechen, die sie möglich machen und damit nie auf einem Titelbild landen.
Diejenigen, die den Hintergrund “finanzieren”, zuhören, auffangen, pflegen,...(wie lange darf eine Aufzählung in so einer Kolumne sein?).
Innovation und erfolgreiche Founder-Stories sind einfach kein fleißiger Einzelfall der Jeffs, Elons und Marks dieser Welt. Sie sind ein soziales Geflecht: getragen von mir als großer Schwester oder bester Freundin, getragen von dir als Mutter oder Partnerin - einfach getragen von uns allen. Und nicht ausschließlich vom einsamen Garagen-Gründer so ganz alleine.
Vielleicht ist es Zeit für eine neue Symbolik.
Statt der Garage: Gemeinschaftsküche, Co-Working-Tisch, Kinderzimmer, Gruppenchat. Wahre Innovation entsteht nicht, wenn einer allein an sich glaubt, sondern wenn viele sich gegenseitig tragen.
Und vielleicht ist genau das die radikalste Erkenntnis:
Dass Erfolg nicht weniger wert ist, wenn er geteilt wird. Und wenn alle Beteiligten auch sichtbar sein dürfen.
Quellen:
¹ Havas Montréal (2018): The Founding Myth of the Garage
² Hills & Singh (2021): The Myth of the Garage – Social Process of Entrepreneurship
³ Panel Study of Entrepreneurial Dynamics (2021)
⁴ Founders Forum Group (2025): Women in VC & Startup Funding Statistics 2025
⁵ Leslie et al. (2015): Expectations of Brilliance Underlie Gender Distributions Across Academic Disciplines, Science 347(6219)
⁶ Fraser, N. (2016): Contradictions of Capital and Care
⁷ LSE Entrepreneurship Centre (2024): Class and Capital in European Startup Founding
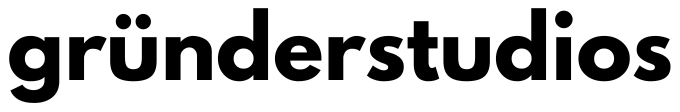
%20(700%20x%20700%20px).png)


