
Ihre Arbeit verbindet technologische Tiefe mit kultureller Relevanz mit dem Ziel, nicht nur Märkte zu erschließen, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung mitzugestalten. Mit einem Master der LSE zur Rolle von Emotionen in gesellschaftlichen Dynamiken und Erfahrung darin, Marken aufzubauen, Strategien zu entwickeln und Kampagnen umzusetzen, arbeitet Rosa an der Schnittstelle von Technologie, Kommunikation und Kultur.
Euer Unternehmen steht vor ähnlichen Fragen? Ich freue mich über den Austausch. Schreibt mir gern an rosa@defemagency.com.
Episode
20
▪
Über marken die bleiben
Die stille Schwäche der Wissenschaft: Warum Gefühl kein Gegensatz zu Präzision ist
Wissenschaft ist die Methodik des überprüfbaren Erkenntnisgewinns. Alles muss belegt, bewiesen und dokumentiert werden, bevor eine Lösung als valide gilt. Schon allein diese Haltung lässt vermeintlich keinen Raum für Emotionen. Aber warum eigentlich?
Ich arbeite mit vielen Unternehmen, die aus der Forschung oder Akademie heraus entstanden sind. Sie bringen eine unschlagbare fachliche Tiefe mit: fundiertes Wissen, langjährige Arbeit, technologische Exzellenz. Theoretisch die perfekte Basis, um Innovationen auf den Markt zu bringen. Doch genau an dieser Schnittstelle beginnt das Problem. Und um das zu verstehen, müssen wir in die Tiefe gehen.
Emotionen – niemand will sie, jede:r hat sie.
Ein klassisches Problem, das mir immer wieder industrieübergreifend auffällt – egal ob in SpaceTech-Firmen, AI-Agenturen oder Industrieunternehmen: Emotionen (natürlich im richtigen Maße) werden als unprofessionell angesehen. Ob wir unsere Tonlage ändern, uns übermäßig freuen oder deutlich sagen, dass uns etwas nicht gefällt – viele Kolleg:innen sehen das als Schwäche, da es eine Atmosphäre kreiert, die schwer zu kontrollieren ist.
Was passiert als Nächstes? Wird es unangenehm? Konflikthaft?
Das ungeschriebene Kredo lautet: lieber vermeiden, „abhaken“ oder die Gefühle anderer als persönlichen Mangel deklarieren, als sich mit dem eigentlichen Problem auseinanderzusetzen.
Emotionen sind unberechenbar. Sie passen nicht in Excel-Tabellen, nicht in Testumgebungen, nicht in Produkt-Roadmaps. Sie lassen sich nicht skalieren, nicht präzise quantifizieren und genau deshalb werden sie oft als Störfaktor behandelt.
Doch genau das ist ein Irrtum.
Denn Emotionen sind kein Fehler im System. Sie sind das System.
Sie beeinflussen, wie wir Entscheidungen treffen, wem wir vertrauen, wofür wir uns begeistern – und wogegen wir uns wehren.
Ein Produkt mag technisch brillant sein. Doch ohne emotionale Resonanz bleibt es abstrakt.
Das gilt im Branding, aber eben auch in der Forschung: Wer nicht versteht, wie sich ein Problem anfühlt, wird keine Lösung entwickeln, die wirklich gebraucht wird.
Gerade in Zeiten, in denen Technologien immer komplexer und Märkte immer dynamischer werden, wird emotionale Intelligenz zur strategischen Notwendigkeit.
Nicht als Gegenspieler:in der Rationalität, sondern als ihr fehlendes Puzzlestück.
Wenn technologische Exzellenz nicht verstanden wird
Kurz vor der Kommerzialisierung geraten Wissenschaftler:innen ins Straucheln. Ihr Produkt ist tief durchdacht, sorgfältig entwickelt, aber kaum jemand versteht es. Warum?
Sie erklären zu kompliziert oder gar nicht, denken vom Produkt statt vom Problem und verlieben sich in die Lösung, bevor sie das Problem wirklich verstanden haben.
Das Ergebnis: Ein Produkt mit Potenzial, die Welt zu verändern, bleibt bedeutungslos.
Und hier kommen Emotionen ins Spiel.
Einfühlungsvermögen wird oft als bloßer Soft Skill gesehen. Tatsächlich ist es viel mehr – nämlich die Grundlage dafür, echte Relevanz zu schaffen.
In einer Welt, in der sich Märkte und Menschen ständig verändern, funktioniert kein starres Denken. Das Problem verändert sich, Lebensumstände verschieben sich und Investitionsgelder fließen zu den Projekten, mit dem meisten Mehrwert fürs Portfolio. Das heißt automatisch, die Lösung muss sich fügen – nicht umgekehrt.
Der blinde Fleck vieler forschungsnaher Start-ups
Sie investieren Zeit in den letzten Schliff, aber zu wenig in die Geschichte, die das Produkt erzählt. Storytelling schafft Atmosphäre und bringt Kontext zu einem theoretischen Produkt, es öffnet die Tür für authentisches Community Building (dt. Gemeinschaftsaufbau), sodass nicht nur Early Adopter (dt. Frühzeitiger Anwender) einem technischen Produkt nacheifern, sondern auch die kommerzielle Mitte.
Ein Produkt muss nicht perfekt sein. Es muss berühren. Und im Gedächtnis bleiben. Ein Unternehmen, das Storytelling besonders gut umgesetzt hat, ist z. B. Northvolt, weil sie es schaffen, komplexe Technologie mit einer klaren Mission, starken Bildern und einem emotionalen Zukunftsversprechen zu verbinden.
Ja, Emotionen haben Platz in der Forschung und zwar genau da, wo Wissenschaft in die Welt tritt. Wenn wir wollen, dass wissenschaftliche Lösungen im echten Leben ankommen, müssen wir beginnen, über reine Testergebnisse hinauszudenken. Wissenschaft darf sich nicht nur mit Daten beschäftigen, sondern mit Menschen.
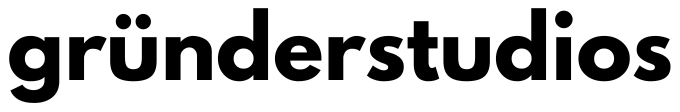
%20(700%20x%20700%20px).png)


