
Ihre Arbeit verbindet technologische Tiefe mit kultureller Relevanz mit dem Ziel, nicht nur Märkte zu erschließen, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung mitzugestalten. Mit einem Master der LSE zur Rolle von Emotionen in gesellschaftlichen Dynamiken und Erfahrung darin, Marken aufzubauen, Strategien zu entwickeln und Kampagnen umzusetzen, arbeitet Rosa an der Schnittstelle von Technologie, Kommunikation und Kultur.
Euer Unternehmen steht vor ähnlichen Fragen? Ich freue mich über den Austausch. Schreibt mir gern an rosa@defemagency.com.
Episode
26
▪
Über marken die bleiben
Warum Kultur heute über Innovation entscheidet
Was ist, wenn wir falsch hinschauen? Wenn wir über Innovation sprechen, denken wir oft an Fortschritt, Technologie, Geschwindigkeit. Wir sprechen von Disruption, Skalierung, exponentiellem Wachstum. Aber selten fragen wir uns, auf welchem Boden dieser Fortschritt eigentlich wächst oder ob er überhaupt wurzeln kann. Denn was uns die Geschichte immer wieder zeigt: Innovation ist nie nur das Ergebnis von Intelligenz oder Investitionen. Sie ist das Produkt von Kultur.
Unsichtbare Strukturen: Warum Kultur entscheidend ist
Die besten Ideen der Welt bleiben bedeutungslos, wenn sie in Umgebungen entstehen, die Angst vor Veränderung haben. In Organisationen, die Kontrolle über Vertrauen stellen. Oder in Systemen, die Anpassung belohnen statt Neugier, und Konformität statt Widerspruch fördern.
Kultur ist das unsichtbare Betriebssystem, das darüber entscheidet, ob Innovation gedeiht oder stirbt. Sie formt unser Denken, unser Handeln, unser Miteinander und damit auch den Raum, in dem Ideen wachsen können.
Nicht jede Kultur trägt Innovation in sich. Und nicht jede Organisation, die sich „innovativ“ nennt, ist es auch. Denn echte Innovation braucht nicht nur Labore, Post-its und Startup-Kollaborationen, sondern auch psychologische Sicherheit, offene Kommunikationsräume, geteilte Verantwortung und vor allem: ein gemeinsames Verständnis davon, wofür wir eigentlich innovieren wollen.
Der Blick zurück
In der Antike, etwa im Römischen Reich, war Fortschritt eingebettet in ein starkes kulturelles Fundament. Mos maiorum, das ungeschriebene Gesetz der Vorfahren, prägte das Selbstverständnis der Gesellschaft. Vertrauen (fides), Pflichtgefühl (pietas), Gemeinsinn schufen ein System, das Innovation nicht nur zuließ, sondern trug.
Infrastruktur war nicht nur Technik, sondern Ausdruck von Ordnung, Dauerhaftigkeit und kollektiver Vision, z. B. in Form römischer Straßen und Aquädukte, die ein kulturelles Ethos verkörperten, das das Gemeinwohl über das Individuum stellte und Innovation langfristig verankerte.¹
Ein ähnliches Zusammenspiel zeigt sich im Goldenen Zeitalter des Islam, besonders in Bagdad des 9. Jahrhunderts. Mit dem Haus der Weisheit (Bayt al-Hikma) entstand ein Zentrum des Wissens, in dem Texte aus Griechenland, Indien und Persien übersetzt, diskutiert und weiterentwickelt wurden. Doch auch hier war es nicht die Technologie allein, die Innovation ermöglichte, es war das kulturelle Klima: die Neugier als religiös-philosophischer Wert, der Austausch mit anderen Kulturen als Stärke, nicht als Bedrohung. Wissenschaft, Kunst und Technik florierten, weil eine Haltung der Offenheit und des kollektiven Lernens tief in der Gesellschaft verankert war.²
Auch die Wikinger verfügten über herausragende Technologie. Ihre Schiffe waren ein Meisterwerk des Designs: schnell, flexibel und ozeantauglich. Um das Jahr 1000 segelten sie nach Vinland (dem heutigen Neufundland) und gründeten eine Siedlung, wie archäologische Funde in L’Anse aux Meadows belegen.³ Doch es war nicht nur die Technologie, die Expansion ermöglichte, sondern das kulturelle Narrativ, das sie trug: der Mut zur Entdeckung, die starke Gemeinschaft an Bord, das kollektive Selbstverständnis als Seefahrer und Pioniere. Als andere Nationen begannen, ihre Technologie zu kopieren, blieb das kulturelle Fundament zurück und mit ihm ihre Führungsrolle.⁴
Mit der Renaissance und später der Industrialisierung verschob sich der Motor der Innovation grundlegend. Fortschritt wurde zur Sache von Planung, Effizienz und strategischem Kalkül. Innovation entstand zunehmend nicht mehr aus einem inneren kulturellen Impuls, sie wurde möglich durch Kolonialisierung, Rohstoffausbeutung und die Externalisierung ökologischer wie sozialer Risiken. Technologischer Fortschritt diente nun weniger dem Gemeinwohl als der Durchsetzung von Interessen.⁵
Das war ein historischer Kipppunkt: Innovation wurde nicht mehr erzählt, sondern berechnet. Anstelle eines inneren Sinns trieb sie nun das Ziel äußerer Verwertbarkeit und wirtschaftlichen Wachstums an.
Der Blick ins Jetzt
Denn was über den Erfolg einer Idee entscheidet, ist selten nur ihre technische Qualität. Es ist die Geschichte, die sie trägt. Die Emotion, die sie weckt. Das Vertrauen, das sie auslöst.
Pathos, Ethos, Logos – Emotion, Glaubwürdigkeit und Logik. Wer all das vereint, erzeugt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern Resonanz.⁶
Steve Jobs verstand das auf radikale Weise. Als er 2008 das iPhone vorstellte, präsentierte er nicht einfach ein technisches Gerät. Er präsentierte ein kulturelles Statement, durchdacht bis ins letzte Detail. Die Benutzeroberfläche, die Verpackung, der ikonische Launch: alles erzählte eine konsistente Geschichte. Eine Geschichte über Zugehörigkeit. Über Menschen, die sich durch Technologie als Teil von etwas Größerem fühlen durften.⁷
Jobs sagte: „The best idea has to win.“ Aber er wusste, dass Ideen nicht im Vakuum gewinnen. Sie brauchen den Raum, die Kultur, die Struktur, damit sie ausgesprochen, geteilt und weitergedacht werden können.
Kultur als Fundament der Erneuerung
Denn: Kultur ist die Summe der Geschichten, die wir über uns selbst erzählen – und darüber, woran wir glauben. Und Innovation entsteht dort, wo eine Gemeinschaft ihre Geschichte ernst nimmt. Und sie scheitert dort, wo man nur laut spricht, aber nichts erzählt.⁸
Dass Kultur und Story zusammengehören, ist kein Zufall. Gemeinschaft entsteht seit jeher durch gemeinsame Erzählungen. Mythen, Symbole, Rituale. Sie stiften Sinn, schaffen Zugehörigkeit und geben dem Einzelnen einen Platz im Ganzen. Ob in antiken Stadtstaaten, in Seefahrernationen oder modernen Organisationen: Wo Menschen sich auf eine gemeinsame Geschichte beziehen können, entsteht die Kraft, wirklich Neues zu schaffen.
Wie einer meiner Lieblingsautoren, Yuval Noah Harari beschreibt, liegt genau darin die Grundlage menschlicher Zusammenarbeit: „Large numbers of strangers can cooperate successfully by believing in common myths.“⁹ (dt. Große Gruppen von Fremden können erfolgreich zusammenarbeiten, wenn sie an gemeinsame Mythen glauben).
Kultivieren vs. Dominieren
Heute leben wir in einer Welt, in der Innovationszyklen sich ständig beschleunigen. Aufmerksamkeitsspannen schrumpfen. Vertrauen ist zu einer knappen Ressource geworden. In dieser Landschaft entscheidet nicht mehr nur die technologische Überlegenheit, sondern ob eine Idee kulturell getragen wird und ob sie Gehör findet.
Und hier liegt der Unterschied zwischen kultivieren und dominieren.
Kultivieren heißt: Räume schaffen, in denen Ideen wachsen dürfen. Zuhören, statt kontrollieren. Verbinden, statt verkaufen.
Dominieren heißt: Märkte mit Macht überrollen. Narrative instrumentalisieren. Wachstum erzwingen, ohne Resonanz. In einer dominierenden Kultur wird Innovation zu einem taktischen Mittel. In einer kultivierten Kultur (eine Lebensweise, die sich an den Wertvorstellungen einer bestimmten sozialen Gruppe orientiert) wird sie zu einem Ausdruck gemeinsamer Vorstellungskraft.¹⁰
Praxisbeispiel: ProsperAI und kulturelle Einführung
Ein Unternehmen, das diesen Unterschied versteht, ist ProsperAI, eine Beratungsfirma, die sich darauf spezialisiert hat, KI-Initiativen in Organisationen nicht nur technologisch, sondern vor allem kulturell tragfähig zu gestalten.
Statt Organisationen neue Technologien aufzuzwingen, beginnt ProsperAI mit der Frage: Ist die Organisation kulturell bereit? Haben die Menschen das Vertrauen, die Sicherheit, die Sprache, um mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten? Technologische Einführung wird nicht als Tool-Rollout verstanden, sondern als kultureller Prozess. Die eigentliche Innovation liegt darin, Emotion, Selbstbild und Entscheidungsräume mitzugestalten, bevor ein System live geht.
Der Blick in die Zukunft
Wenn wir über Kultur in der Zukunft sprechen, kommen wir am Thema Klimawandel nicht vorbei, er schwebt wie ein Damoklesschwert über uns und zwingt uns, grundlegende Fragen neu zu stellen: Welche Art von Innovation wollen wir fördern? Und auf welchem kulturellen Fundament soll sie entstehen?
Gleichzeitig leben wir im Schatten einer gewaltigen Herausforderung, die uns alle betrifft: dem Klimawandel. Er ist mehr als eine ökologische Krise: er ist ein kultureller Stresstest. Denn er zwingt uns zu erkennen, dass Innovation nicht länger in isolierten Silos entstehen darf. Sie braucht Gemeinschaft. Sie braucht Vertrauen. Und sie braucht eine neue Art von Resilienz. Eine, die nicht auf Kontrolle, sondern auf Verbindung beruht.
Man stelle sich zwei Teams vor, die einen Sensor zur landwirtschaftlichen Frühwarnung entwickeln – ein Werkzeug, das im Klimawandel über Ernte oder Missernte entscheiden kann. Beide haben Zugang zu Technologie. Doch nur eines schafft es, Vertrauen aufzubauen – nicht durch Features, sondern durch eine geteilte Geschichte. Genau darin liegt der Unterschied: zwischen technischer Lösung und kultureller Wirkung.
Vielleicht ist das, so paradox es klingt, eine der wenigen positiven Seiten des Klimawandels: Er zwingt uns, gemeinsam zu handeln. Nicht aus Idealismus, sondern aus Notwendigkeit. Und in dieser Notwendigkeit liegt eine Chance. Eine Chance, Innovation neu zu denken. Nicht als Leistung Einzelner, sondern als Ausdruck eines kollektiven Kulturwandels.
Was wir brauchen: Radikale Resilienz
Radikale Resilienz, das ist vielleicht das, was wir in dieser Zeit am dringendsten brauchen. Nicht als Härte gegenüber Krisen, sondern als kulturelle Fähigkeit, neue Geschichten zuzulassen. Andere Perspektiven. Stille Stimmen. Räume, in denen Menschen sich trauen, etwas zu sagen, weil sie wissen, dass es gehört wird.
Denn am Ende entscheidet nicht Technologie über unsere Zukunft. Sondern das, was wir daraus machen.
Die zentrale Frage ist nicht: Hast du eine bahnbrechende Idee?
Sondern: Hast du eine Kultur, in der sie überleben kann?
Quellen:
¹ Encyclopaedia Britannica – Roman law and society, Abschnitt zu Infrastruktur, Gemeinwohl und mos maiorum.
² Encyclopaedia of Islam; Jonathan Lyons – The House of Wisdom: How the Arabs Transformed Western Civilization(2009).
³ The Guardian – Vikings settled North America 1000 years ago, archaeologists say, 2021.
⁴ Wikipedia – Viking expansion (https://en.wikipedia.org/wiki/Viking_expansion).
⁵ Jason Hickel – The Divide: A Brief Guide to Global Inequality and its Solutions (2017).
⁶ Walter Isaacson – Steve Jobs (2011), insbesondere Kapitel zur iPhone-Einführung.
⁷ Clifford Geertz – The Interpretation of Cultures (1973); vgl. auch Brené Brown – Dare to Lead (2018).
⁸ Yuval Noah Harari – Sapiens: A Brief History of Humankind (2011), Kapitel „The Tree of Knowledge“.
⁹ Aristoteles – Rhetorik, insbesondere Buch I, Kapitel 2 (Pathos, Ethos, Logos).
¹⁰ Stuart Hall – Cultural Identity and Diaspora, in: Identity: Community, Culture, Difference, Hg. Jonathan Rutherford (1990).
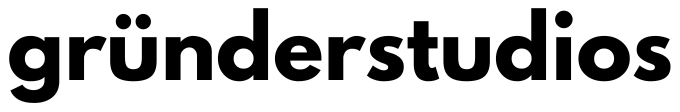
%20(700%20x%20700%20px).png)


