„Am Anfang dachte ich, man muss sich im Sales verstellen, doch das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die Frage ist: Würde ich an Stelle der Kund:innen kaufen? Wenn ich sie aufrichtig beantworte, verstehe ich Kund:innen besser.” Vertrieb gilt als Kampf um Aufmerksamkeit und Budgets. Doch mit sinkendem Vertrauen in klassische Sales-Methoden zeigt sich ein neuer Weg: Empathie. Gründer von Empathie Sales GmbH und Vertriebsstratege Julian Scharf erzählt, wie er durch Zuhören nicht nur Deals gewinnt. Er hat unzählige Gespräche geführt - mit Startups, Konzernen, Menschen, die schon zehn Tools ausprobiert haben, und solchen, die am liebsten gar nicht erst ans Telefon gehen.
Zusammen mit ihrer Co-Gründerin Emily hat sie den EmpowHerCircle ins Leben gerufen, ein Netzwerk für ambitionierte Gründerinnen. Entstanden aus dem EmpowHerNetwork, ein Netzwerk mit über 450 Mitgliedern im DACH-Raum und einer Mischung aus Wissen, Events und Trends aus der Gründungszene. Als Unternehmerin, Mutter und Netzwerkerin steht sie für eine Wirtschaft, die von Mut, Zusammenarbeit und echter Innovation geprägt ist und dafür, dass Erfolg nicht durch Konkurrenz, sondern durch Verbindung entsteht.
Kooperationen sind kein Trend, sie sind ein unternehmerisches Prinzip. Eines, das besonders in der Frühphase von Gründungen nicht nur wertvoll, sondern oft überlebenswichtig ist. Denn wer keinen Zugang zu Kapital, Netzwerken oder Marktanteilen hat, kann über klug gewählte Partnerschaften genau das erschließen. Nur: Die meisten Gründer:innen haben nie gelernt, wie Kooperationen wirklich funktionieren.
Was wir stattdessen sehen, sind oft spontane „Zusammenarbeiten“, die sich wie Kooperations-Kosmetik anfühlen. Aktionen ohne echte Substanz. Oder man geht direkt in den Vertriebsmodus und erwartet Ergebnisse, bevor überhaupt Vertrauen entstehen konnte.
Dabei gilt: Kooperationen sind kein Pitch, sondern ein Prozess. Und der beginnt mit Haltung, nicht mit PowerPoint, Canva oder Asana.
OECD-Berichte betonen, wie zentral Netzwerke für KMUs sind: Rund 99 % aller Unternehmen in OECD-Staaten sind kleine oder mittelständische Unternehmen, die etwa 50–60 % aller Arbeitsplätze und Wertschöpfung ausmachen. Ihre Integration in Innovations‑ und Handelsnetzwerke ist daher essenziell.1
Denn wenn KMUs den Großteil der Wirtschaftsleistung tragen, sind sie nicht nur relevant für Stabilität und Beschäftigung, sondern auch entscheidend für Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit ganzer Volkswirtschaften. Werden sie von strategischen Netzwerken ausgeschlossen, etwa weil ihnen der Zugang zu Kapital, Technologien oder Märkten fehlt, bleibt enormes Potenzial ungenutzt. Genau deshalb ist ihre aktive Einbindung kein Nice-to-have, sondern ein wirtschaftspolitisches Muss.
Und obwohl viele OECD‑Länder politische Anstrengungen unternehmen, um Start-ups und KMUs in Innovationsnetzwerke einzubinden, zeigen OECD-Daten, dass dieser Zugang bundesweit sehr unterschiedlich umgesetzt wird.2
Kooperationen sind ein Beziehungsgeschäft
Gute Kooperation entsteht nicht durch Formulare oder Standardmails, sondern durch echte Verbindung. Wer kooperieren will, muss bereit sein, sich mit der Realität der anderen Person auseinanderzusetzen:
Was braucht sie wirklich? Was ist ihr Ziel? Und was sind ihre Ängste?
Diese Fragen sind unbequem, aber genau darin liegt der Unterschied zwischen einem einmaligen Deal und einer langfristigen Win-Win-Partnerschaft.
Wichtiger Hebel: Der Perspektivwechsel.
Viele Gründer:innen fokussieren sich auf ihre eigenen Engpässe („Ich brauche Reichweite“, „Ich brauche Kunden“). Erfolgreicher wird es, wenn man den Spieß umdreht:
Welches Problem kann ich für mein Gegenüber lösen?
Erst dann wird aus einer Anfrage ein Angebot. Und aus einem Wunsch nach Umsatz ein konkreter Hebel dafür.
Wie finde ich die richtigen Kooperationspartner:innen?
Kooperationen funktionieren nicht zwischen Logos, sie funktionieren zwischen Menschen und Unternehmen.
Die besten Kooperationen entstehen dort, wo Werte, Zielgruppen und Visionen sich ergänzen oder gegenseitig verstärken. Das braucht Klarheit, vor allem über sich selbst:
- Wofür stehe ich und wofür nicht?
- Welches konkrete Problem löse ich für wen?
- Wie will ich wirken und in welchen Märkten bin ich unterwegs?
Ohne diese Reflexion wird jede Partnerschaft zum Zufallsprodukt. Mit ihr wird sie zum strategischen Werkzeug.
McKinsey‑Analysen bescheinigen, dass Unternehmen, die Ökosysteme und Allianzen aktiv gestalten, robuster wachsen und widerstandsfähiger werden. Rund 50 % der sogenannten „Resilience Leader“, also besonders krisenstarke Unternehmen, setzen systematisch auf Kooperationsstrategien.3 Das zeigt: Wer Kooperationen bewusst und strukturiert angeht, verschafft sich einen Vorsprung.
Den Einstieg finden Unternehmen durch modular aufgebaute Angebote, die Unternehmen dabei unterstützt, passende Kooperationspartner zu identifizieren, erste Kontakte herzustellen und gemeinsam wirksame Ideen zu entwickeln mit dem Ziel, dass die Kooperationen strategisch auf die unterschiedlichen Ziele und Konten beider Seiten einzahlen.
Kooperation als echter Umsatztreiber
Kooperationen können Vertriebsstrukturen hebeln, neue Kundensegmente erschließen oder Produkte effizienter vermarkten, wenn sie nicht aus dem Bauch heraus, sondern mit System initiiert werden.
Unternehmen mit starken Allianzen und Netzwerkbeteiligungen wachsen deutlich schneller und widerstandsfähiger, da sie Innovationen effizienter gestalten können.4
Und eine Bericht von McKinsey zeigt: Nur etwa 10–15 % traditioneller Unternehmen erzielen über Ökosysteme signifikant höhere Umsätze aus nicht‑kernkompetenten Bereichen, aber wer das schafft, gewinnt echten Wettbewerbsvorteil.5
Auch das Startup Genome Project kommt in seiner globalen Analyse zu dem Ergebnis: Startups, die aktiv mit anderen Unternehmen kooperieren (insbesondere in Sales, Produktentwicklung und Distribution), haben eine 3,5-fach höhere Wahrscheinlichkeit, in neue Märkte zu skalieren.6
Der Schlüssel: Zusammenarbeit nicht als kurzfristiges Projekt denken, sondern als Teil des Geschäftsmodells.
Beispiel:
Statt Provision für jeden einzelnen Lead zu zahlen, denken wir Beteiligungsmodelle mit gemeinsamer Zieldefinition.
Statt „mal was gemeinsam auf LinkedIn zu posten“, entwickeln wir Formate mit echtem Mehrwert für beide Zielgruppen.
Statt „wer liefert was“, fragen wir: Was können wir nur gemeinsam erreichen?
Das verändert alles, auch den Umsatz.
Kooperationen sind kein Hack. Sie brauchen Klarheit, Geduld und den Mut, in Beziehungen statt in Transaktionen zu denken. Aber wenn sie gelingen, werden sie zu dem, was viele sich von Werbung, Kaltakquise oder Funding erhoffen:
Ein echter Hebel für Wirkung und Wachstum.
Quellen:
1 OECD (nd): SME indicators, benchmarking and monitoring
2 OECD (2023): OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2023
3 McKinsey & Company (2023): Growth and resilience through ecosystem building
4 McKinsey & Company (2023): Growth and resilience through ecosystem building
5 McKinsey & Company (2023): Growth and resilience through ecosystem building
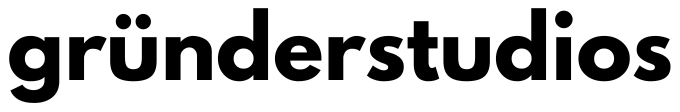

.png)
.png)